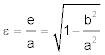Die Ellipse
Die typischen (terrestrichen) Navigationsaufgaben an der Küste und auf dem Großkreis gehen von einer Kugelgestalt der Erde aus. Die Grundlage ist die euklidische Geometrie. Mit dieser Vereinfachung macht man beim Navigieren in Küstengewässern Fehler in der Größenordnung von maximal einigen hundert Metern. Will man genauer Navigieren oder genauere Karten konstruieren, muss man die tatsächliche Form der Erde durch ein Ellipsoid annähern. Damit erreicht man Land- und Revier-Seekarten, die eine Genauigkeit in der Größenordnung einiger Dezimeter haben. Die Annäherung der Erdoberfläche an ein Ellipsoid ist auch die Grundlage der satellitengestützten Navigation mit GPS (sowohl auf der Straße als auch auf See). Der Nachteil dieser Geometrie auf der Ellipse ist, dass man keine einfachen, mit dem Rechenschieber oder Taschenrechner zu lösende, Formeln mehr ableiten kann. Man braucht schon Computer. Diese Geometrie ist die nicht-euklidische Geometrie.
Für die terrestrische Navigation — bei der Entfernungen auf der Erdoberfläche berechnet werden — brauchen wir die Mittelpunktsgleichung der Ellipse in karthesischen und in Polarkoordinaten und die Scheitelgleichung. Die Astronomie rechnet dagegen die Stellungen der Gestirne mit der Brennpunktsgleichung in karthesischen und in Polarkoordinaten.
Die Geometrie der Ellipse
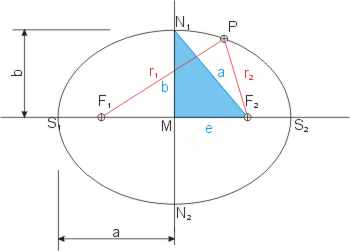 Betrachten wir die Ellipse. Jeder Punkt P auf ihr hat von zwei Punkten F1 und F2 den gleichen Abstand r1 + r2 = 2 · a. (Auf dieser Definition basiert die Gärtnerkonstruktion der Ellipse.) Die Ellipse sieht aus, wie ein gestauchter Kreis. Statt eines Radius gibt es zwei, die große (a) und kleine (b) Halbachse heißen. Die beiden Punkte F1 und F2 sind die Brennpunkte der Ellipse. Sie liegen auf der Hauptachse und die schneidet die Ellipse in den Hauptscheiteln S1 und S2. Die Nebenachse steht auf der Hauptachse senkrecht und geht durch den Mittelpunkt M der Ellipse. Ihre Schnittpunkte mit der Ellipse sind die Nebenscheitel N1 und N2. Es gilt im rechtwinkligen blauen Dreieck der Satz des Pythagoras: a2 = b2 + e2.
Betrachten wir die Ellipse. Jeder Punkt P auf ihr hat von zwei Punkten F1 und F2 den gleichen Abstand r1 + r2 = 2 · a. (Auf dieser Definition basiert die Gärtnerkonstruktion der Ellipse.) Die Ellipse sieht aus, wie ein gestauchter Kreis. Statt eines Radius gibt es zwei, die große (a) und kleine (b) Halbachse heißen. Die beiden Punkte F1 und F2 sind die Brennpunkte der Ellipse. Sie liegen auf der Hauptachse und die schneidet die Ellipse in den Hauptscheiteln S1 und S2. Die Nebenachse steht auf der Hauptachse senkrecht und geht durch den Mittelpunkt M der Ellipse. Ihre Schnittpunkte mit der Ellipse sind die Nebenscheitel N1 und N2. Es gilt im rechtwinkligen blauen Dreieck der Satz des Pythagoras: a2 = b2 + e2.
Hinweis:Bei einer gegebenen Ellipse findet man die Brennpunkte als Schnittpunkte eines Kreises mit dem Radius der großen Halbachse um einen Nebenscheitel mit der großen Achse.
Die lineare Exzentrizität
Die Abstände der Brennpunkte F1, 2 vom Mittelpunkt sind gleich. Man nennt den Abstand MF1 = MF2 die lineare Exzentrizität e oder die Brennweite der Ellipse. Man berechnet e nach Pythagoras im rechtwinkligen, blauen Dreieck. Da der Nebenscheitel N1 ein Punkt auf der Ellipse ist, beträgt sein Abstand von den Brennpunkten 2 · a. Die Hypotenuse im blauen Dreieck hat also die Läge a, die senkrechte Kathete entspricht der kleinen Halbachse. Also gilt b2 + e2 = a2, oder:
Die numerische Exzentrizität
Zur Navigation interessiert uns besonders der Abstand zweier Punkte auf der Ellipse. Aber schon die Berechnung des Umfangs ist mit einfachen Mitteln nicht mehr zu bewerkstelligen. Das geht nur durch Integrieren einer Differentialgleichung in Polarkoordinaten. Um die Formeln abzuleiten, brauchen wir noch die numerische Exzentrizität ε.
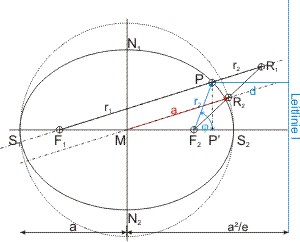 Die numerische Exzentrizität ε ist definiert als Quotient aus linearer Exzentrizität e und der Länge a der großen Halbachse:
Die numerische Exzentrizität ε ist definiert als Quotient aus linearer Exzentrizität e und der Länge a der großen Halbachse:
Die Leitlinie l ist geometrisch am Kegel erkennbar. Sie liegt parallel zur Nebenachse und schneidet die Apsidenlinie (x-Achse) so, dass ihr Abstand vom Scheitel S2 sich zu dem des Brennpunkts F2 verhält wie die große Halbachse a zur linearen Exzentrizität. Ihr Abstand vom Mittelpunkt M der Ellipse ist a2 ⁄ e. Das Verhältnis der Abstände jedes Punktes P auf der Ellipse vom Brennpunkt F2 und dieser Leitlinie ist konstant r2 ⁄ d = konstant.
Die Leitlinie l hat vom Scheitel S2 den Abstand (a2 ⁄ e) - a, und ein Ellipsenpunkt P den Abstand d = a2 ⁄ e - x (x ist die x-Koordinate des Punktes P und entspricht der Strecke MP′). Die Abstände r1 und r2 des Ellipsenpunktes P von den beiden Brennpunkten F1 und F2 sind die Hypotenusen in den rechtwinkligen Dreiecken F1PP′ bzw. F2PP′. Die beiden Dreiecke haben die Kathete y = PP′ gemeinsam, die anderen Katheten haben die Längen F1P′ = 2·e + (x - e) und F2P′ = x - e.
Mit dem Satz des Pythagoras können wir nun zwei Gleichungen für die Kathete y aufstellen:
- im Dreieck F1PP′: y² = r1² - (2·e + (x - e))²
- im Dreieck F2PP′: y² = r2² - (x - e)²
- damit:
- r1² - (x + e)² = r2² - (x - e)²
Aufgelöst nach r1² und ausmultipliziert ergibt: r1² = r2² + 4·e·x, oder r1² - r2² = 4·e·x = (r1 + r2)·(r1 - r2).
Da r1 + r2 = 2·a kann man die vorige Gleichung dividieren und erhält r1 - r2 = 2·e·x ⁄ a. Oder nach Einsetzen der Definition der Ellipse und aufgelöst: r1 = a + e·x ⁄ a bzw. r2 = a - e·x ⁄ a.
Diese letzte Gleichung kann man auf beiden Seiten mit a multiplizieren und nach x auflösen: x = (a² - r1·a) ⁄e. Diesen Ausdruck für x setzt man in die Gleichung für den Abstand d des Ellipsenpunkts P von der Leitlinie ein, und erhält: d = r1·(a ⁄ e). Daraus die Beziehung d ⁄ r1 = a ⁄ e. Damit ist gezeigt, dass das Verhältnis der Abstände eines beliebigen Ellipsenpunktes vom Brennpunkt und von der Leitlinie konstant ist, und nur von Parametern der Ellipse abhängt. Der Kehrwert dieses Verhältnisses wird numerische Exzentrizität ε genannt. Anschaulich erkennt man die numerische Exzentrizität aus dem Bild der Entstehung der Kegelschnitte.
In der Abbildung oben iat auch eine geometrische Konstruktion der numerische Exzentrizität eingezeichnet. Man verlängert den Strahl vom entfernteren Brennpunkt F1 zum Punkt P auf der Ellipse um den Abstand von P zum näheren Brennpunkt r2, und erhält den Punkt R1. Der Schnittpunkt einer Parallelen zu PR1 (= 2·a) durch den Mittelpunkt der Ellipse schneidet die Verbindungslinie von R1 und F2 im Punkt R2, der auch auf dem Umkreis der Ellipse liegt. MF2 = e und MR2 = a. Mit Hilfe eines Proportionallineals kann man nun das Verhältnis e ⁄ a berechnen. (Edmund Gunter erklärt das ausführlich im 2. Buch des Sectors, Kap. II unter 5.)
Die Ellipse und ihr Umkreis
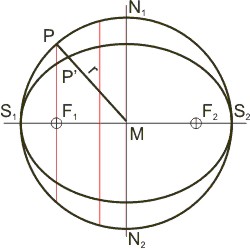 Die Ellipse ist ein affines Abbild des Kreises — man staucht den Kreis einlang einer der Achsen und erhält die Ellipse. Daher spielt der Kreis, aus dem die Ellipse entstanden ist, für viele Berechnungen der Ellipse nach der Euclidschen Trigonometrie eine ausschlaggebende Rolle. Beispiele sind Kepler, Newton und Gauss. Der Durchmesser des Umkreises ist gleich der großen Ellipsenachse, die Mittelpunkte von Ellipse und Umkreis fallen zusammen. Nach Appolonius von Perge verhalten sich die Sehnen von Ellipse und Kreis, die senkrecht auf der großen Achse stehen, wie die kleine zur großen Halbachse der Ellipse. Die Sehne, die durch einen der Brennpunkte der Ellipse geht, heißt Ellipsenparameter 2·p. Man berechnet sie im rechtwinkligen Dreieck ΔP'F1M aus der großen und der kleinen Halbachse, a bzw. b, nach dem Satz von Pythagoras. Bekannt sind ja die Hypotenuse r = a und die Strecke MF1 = e (die lineare Exzentrizität); daraus erhält man die Länge der Halbsehne F1P', und die verhält sich zur Ellipsenhalbsehne F1P wie die große Halbachse der Ellipse a zur kleinen b.
Die Ellipse ist ein affines Abbild des Kreises — man staucht den Kreis einlang einer der Achsen und erhält die Ellipse. Daher spielt der Kreis, aus dem die Ellipse entstanden ist, für viele Berechnungen der Ellipse nach der Euclidschen Trigonometrie eine ausschlaggebende Rolle. Beispiele sind Kepler, Newton und Gauss. Der Durchmesser des Umkreises ist gleich der großen Ellipsenachse, die Mittelpunkte von Ellipse und Umkreis fallen zusammen. Nach Appolonius von Perge verhalten sich die Sehnen von Ellipse und Kreis, die senkrecht auf der großen Achse stehen, wie die kleine zur großen Halbachse der Ellipse. Die Sehne, die durch einen der Brennpunkte der Ellipse geht, heißt Ellipsenparameter 2·p. Man berechnet sie im rechtwinkligen Dreieck ΔP'F1M aus der großen und der kleinen Halbachse, a bzw. b, nach dem Satz von Pythagoras. Bekannt sind ja die Hypotenuse r = a und die Strecke MF1 = e (die lineare Exzentrizität); daraus erhält man die Länge der Halbsehne F1P', und die verhält sich zur Ellipsenhalbsehne F1P wie die große Halbachse der Ellipse a zur kleinen b.
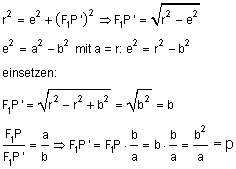
- Also: p = b² ⁄a.
Dieser Zusammenhang von Ellipse und Umkreis ermöglichte Kepler, seine Gesetze mathematisch abzuleiten (ebenso verwenden Newton und Gauss den "Ellipsenparameter").
Die sieben Bücher des Appolonius von Perge sind im Web zu finden.
- Stichworte zu Kegelschnitten und Ellipse:
- Die Geometrie der Ellipse
- Die lineare Exzentizität
- Die numerische Exzentizität
- Ellipse und Umkreis
- Mittelpunktsgleichung der Ellipse
- Polare Mittelpunktsgleichung der Ellipse
- Umfang der Ellipse
- Fläche des Ellipsensektors
- Scheitelgleichung der Ellipse
- Brennpunktgleichung der Ellipse
- Leitlinie
- Kegelschnitte
- Die Kepler-Gleichung